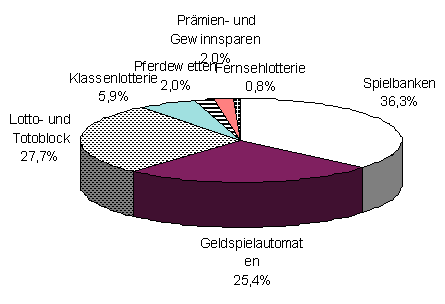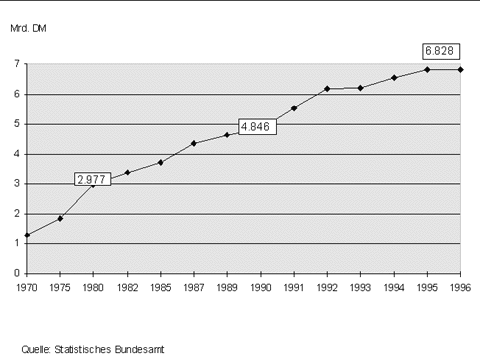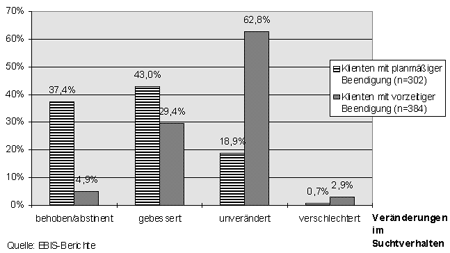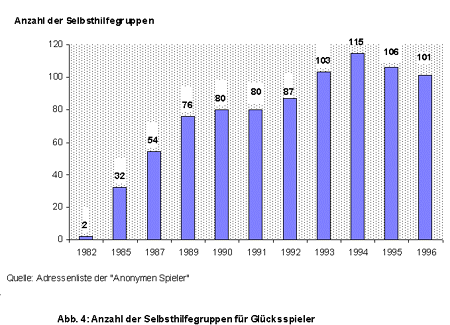Glücksspiel - Zahlen und Faktenvon Gerhard Meyer, Universität Bremen Umsätze auf dem Glücksspiel-Markt und Einnahmen des Staates Die Umsätze auf dem Glücksspiel-Markt (ohne Soziallotterien) beliefen sich in 1996 auf rd. 43,3 Mrd. DM, nach 41,7 Mrd. DM in 1995 (Tab. 1). Dies entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,7%, die damit deutlich über dem Anstieg des gesamtwirtschaftlichen Konsums in Höhe von 1,5% in 1996 liegt. Tabelle 1: Umsätze auf dem Glücksspiel-Markt (in Mio. DM)
- Roulette, Glücksspielautoma- ten, Black Jack, Baccara 2.000 6.700 13.600 14.800 14.600 15.700 + 7,5 - Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit 8.800 10.500 11.000 + 4,8 - Zahlenlotto - Fußballtoto - Rennquintett - Spiel 77 - Super 6 - Glücksspirale - Rubellotterien Gesamt 2.752 279 59 - - 107 - 3.197 5.152 324 30 856 25 83 - 6.470 8.105 328 5 1.568 448 310 562 11.326 8.869 307 4 1.716 1.007 338 506 12.746 8.358,1 332,2 3,3 1.623,7 973,4 369,1 503,1 12.162,9 8.305,1 309,3 2,6 1.570,0 959,6 351,4 475,6 11.973,7 - 0,6 - 6,9 - 20,1 - 3,3 - 1,4 - 4,8 - 5,5 - 1,6 - Nordwestdeutsche - Süddeutsche - 271 1.020 1.202 1.497,0 1.646,8 + 10,0 - ARD - ZDF 195 209 189 178,8 201,0 + 12,4 - PS-Sparen - Gewinnsparen 62 252 270 286,5 298,0 + 4,0 - Galopper (Totalisator) - Traber ( Totalisator) - Buchmacher 236 138 375 116 413 203 403 229 393,0 236,8 369,8 238,4 - 5,9 + 0,3 40.350 Quelle:?Archiv- und Informationsstelle der deutschen Lotto- und Toto-Unternehmen, ?Institut für Wirtschaftsforschung, eigene Erhebung
Einen erneuten Rückgang der Umsätze hat der Deutsche Lotto- und Totoblock zu verzeichnen. Die Einbußen lagen insgesamt bei 1,6%, beim größten Umsatzträger, dem Lotto "6 aus 49", fielen sie mit 0,6% noch am geringsten aus. Weniger Geld setzten die Spieler vor allem in den Bundesländern ein, die noch nicht über das Online-System in den Annahmestellen verfügen. Die Erhöhung der Spieleinsätze (von 1,25 auf 1,50 DM), eine zusätzliche Gewinnklasse (4 Richtige mit Zusatzzahl), eine neue Lotto-Show, die Reform des Fußball-Totos sowie der Ausbau des Online-Systems sollen zukünftig für ein wachsendes Interesse der Spieler sorgen. Die Klassenlotterien konnten dagegen abermals kräftige Zuwächse erzielen - nicht zuletzt dank der aufdringlichen Werbung, die in persönlichen Anschreiben das Erzielen eines Hauptgewinnes suggeriert. Glücksspiele mit höherem Suchtpotential, wie Geldspielautomaten und Angebote in der Spielbank, weisen ebenfalls Umsatzsteigerungen auf. Ihre Anteile an dem Gesamtumsatz lagen bei 25,4 bzw. 36,3% (Abb. 1).
Mit dem Spiel um Groschen an 235.000 Geldspielautomaten wurden nach Schätzung des Instituts für Wirtschaftsforschung in 1996 rd. 11 Mrd. DM umgesetzt. Bei Spielergewinnen von gut 60% verblieb der Branche ein Brutto-Spielertrag (Kasseninhalt) von 4,28 Mrd. DM. Weitere Zuwächse versprechen sich die Automatenaufsteller von einer Änderung der Spielverordnung, nach der 12 statt bisher 10 Geldspielautomaten je Spielhalle bei einem Raumangebot von mindestens 150 m2 aufgestellt werden können. Über einen entsprechenden Antrag des Bundesministeriums für Wirtschaft wird voraussichtlich im Herbst 1997 im Bundesrat entschieden. Gleichzeitig verstoßen die Hersteller von Geldspielautomaten weiterhin gegen ihre eigenen "freiwilligen, selbstbeschränkenden Vereinbarungen": An Geldspielautomaten können Spieler in einer Folge von Sonderspielen über Angebote zum Risikospiel mehr als die vereinbarten 150 Sonderspiele gewinnen. Bei einer Trefferhäufigkeit von 70% und einer Merkmalsübertragung, die aus 100 Sonderspielen durchschnittlich 135 Sonderspiele werden läßt, betrug der mittlere Gewinn einer Serie bisher 378 DM (bei einem Einsatz von 0,40 DM). Über die Aufhebung der Begrenzung können Serien einen mittleren Gewinnbetrag von 540 DM erbringen. Dies bedeutet, daß der Spieler den ganzen Tag darauf hoffen kann, das verspielte Geld "mit einem Schlag" zurückzugewinnen, obwohl ein solcher Gewinn nur alle zwei bis drei Wochen auftritt. Ein zugelassener Gerätetyp verstößt sogar gegen die Spielverordnung. An dem Gerät "Xtra Pot" kann der Spieler eine 50er-Xtra-Serie über das Risikospiel gewinnen, die durch Übertragung eines ihr eigenen Merkmals (sofern in dieser Serie riskiert wird) auf eine Serie mit mittlerem Gesamtumfang von 156,25 Sonderspielen anschwillt. In einem Spiel können so mehr als 150 DM riskiert werden, um einen mittleren Gewinnbetrag von 381,75 DM zu erzielen. Laut Spielverordnung dürfen bei Betätigung der Risikotaste aber nicht mehr als 50 Sonderspiele gewonnen werden. Im Zuge der Einführung des Euro strebt die Branche darüber hinaus eine Erhöhung des Spieleinsatzes an. Vorgeschlagen wird das 30-Cent-Spiel. Bei dem derzeitigen Wechselkurs (1 Euro = 1,89 DM) entspräche dies einem Einsatz pro Spiel von 0,57 DM, verbunden mit höheren Gewinnanreizen und Verlustmöglichkeiten für die Spieler. Schon jetzt übersteigt der stündliche Durchschnittsverlust von 38,40 DM an einem Gerät den durchschnittlichen Stundenlohn eines (westdeutschen) Industriearbeiters (brutto: 25,96 DM) bei weitem, so daß die juristische Unterscheidung zwischen Geldspielautomaten als "Unterhaltungsautomaten mit Gewinnmöglichkeit" (Gewerberecht) und "Glücksspielen" (Polizei- und Ordnungsrecht) nicht mehr haltbar ist. Bis zur Klärung dieser Rechtsfrage, die hoffentlich bald in Angriff genommen wird, bleibt den Kommunen die Erhebung von Vergnügungssteuern, um gesundheitspolitische Lenkungsziele zu verfolgen (1996: 587,5 Mio. DM). Wie das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, "ist die Auswahl des Steuergegenstandes für die Spielautomatensteuer durch das Ziel gerechtfertigt, der Verbreitung der Spielsucht entgegenzuwirken. Das Lenkungsziel besteht dabei (...) in dem Bemühen, ein Verhalten, das Folgekosten für die Gemeinschaft verursachen kann, unattraktiv zu machen" (Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 1. März 1997, Az.: 2 BvR 1599/89 - 2 BvR 1714/92 - 2 BvR 1508/95). Die obere Grenze vertretbarer Steuersätze, die die Rentabilität der Geräte herabsetzen und ihre Anzahl verringern könnte, dürfte in vielen Städten und Gemeinden noch nicht erreicht sein. Die Spielbanken konnten ihren Umsatz in 1996 um 7,5% steigern, u. a. dank der Neueröffnungen in Stuttgart und Halle. 7 Millionen Gäste besuchten die derzeit 42 deutschen Spielbanken - 14 zusätzliche Casinos sind bis zum Jahr 2000 geplant. Der Brutto-Spielertrag der Spielbanken, d. h. der verbleibende Betrag nach Abzug wiederausgeschütteter Gewinne (ohne Kostenanrechnung), stieg um rd. 100 Mio. DM auf 1,412 Mrd. DM. Tabelle 2: Bruttospielertrag der Glücksspiele in Spielbanken (in Mio. DM) Das Roulette verliert weiter an Bedeutung (Tab. 2). Zwar erhöhte sich der Brutto-Spielertrag um 2,3%, gleichzeitig legte der Ertrag der Glücksspielautomaten aber um 11,5% zu. Ihr Anteil am Gesamtertrag stieg auf 56%. In den Tronc sollen in den vergangenen Jahren weniger Gelder geflossen sein, als bisher angenommen. Immerhin noch 125 Mio. DM sollen die "Zocker" (trotz ihrer Verluste) in die "Trinkgeldkasse" der Spielbanken eingezahlt haben (nach 126 Mio. DM in 1995).
Die Einnahmen des Staates aus Glücksspielen (über Rennwett- und Lotteriesteuer, Gewinnablieferung verschiedener Lotterien, Spielbankabgabe) betrugen 6,828 Mrd. DM in 1996, nach 6,804 Mrd. DM in 1995 - eine Steigerung um 0,4% (Abb. 2). Von den Gesamteinnahmen wurden 444 Mio. DM (1995: 440 Mio. DM) bzw. 6,5% in den neuen Bundesländern erwirtschaftet.
Pathologisches Glücksspiel Nach der Jahresstatistik 1996 der ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke (EBIS) ist in 436 Einrichtungen bei 1.520 Klienten die Einzeldiagnose "Pathologisches Spielverhalten" gestellt worden (Tab. 3). Ihr Anteil unter den Zugängen mit abgeschlossener Diagnosestellung lag damit bei 2,3% (Männer: 3,1%; Frauen: 0,5%). Die Diagnose betraf 1.257 bzw. 158 Männer und 97 bzw. 8 Frauen in den alten bzw. neuen Bundesländern. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die absolute Zahl behandelter Personen mit Spielproblemen angestiegen. Einem Zuwachs von 19,8% bei den Einzeldiagnosen steht eine Zunahme von 2,9% bei den Hauptdiagnosen (1994: 998, 1995: 1.028, 1996: 1.058) gegenüber. Aufgrund der höheren Gesamtzahl erfaßter Klienten hat sich der Anteil aber geringfügig verringert. Tabelle 3: Pathologisches Spielverhalten bei Klienten ambulanter Beratungs- und Behandlungsstellen, Zugänge: Einzeldiagnosen
Einzeldiagnose Beratungsstellen N = 396 N = 469 N = 436 Der Vergleich von Klienten mit unterschiedlichen Hauptdiagnosen hinsichtlich der Verschuldung zeigt auf (Tab. 4), daß pathologische Spieler deutlich höhere Schulden aufweisen. Der Anteil von Klienten, die keine Schulden haben, ist mit 15,1% vergleichsweise gering. Bei mehr als der Hälfte (55,8%) beträgt die Verschuldung über 10.000 DM, während dies beispielsweise nur 23,3% der Opiatabhängigen oder 30,4% der Kokainabhängigen betrifft. Tabelle 4: Hauptdiagnose und Verschuldung bei Klienten ambulanter Beratungs- und Behandlungsstellen (Männer)
Ausmaß der Verschuldung (in DM) Quelle: EBIS-Berichte Für die Klienten, die eine Therapie im engeren Sinne durchlaufen und planmäßig abgeschlossen haben, konnte aus Sicht der Therapeuten ein beachtlicher Erfolg bezüglich des süchtigen Spielverhaltens erreicht werden (Abb. 3). 37,4% wurden als abstinent und 43% als gebessert eingestuft. Wurde die Behandlung allerdings vorzeitig beendet, war bei 62,8% der Klienten keine Veränderung im Suchtverhalten feststellbar. Der Anteil der Abbrüche durch die Klienten liegt mit 53% (Männer) bzw. 51% (Frauen) - auch im Vergleich mit stoffgebundenen Abhängigkeiten - relativ hoch.
In (ausgewählten) stationären Therapieeinrichtungen ist gegenüber 1995 ein leichter Anstieg der Anzahl durchgeführter Behandlungen von pathologischen Spielern erkennbar (Tab. 5). Insgesamt wurden in den fünf Einrichtungen in 1996 264 Spieler behandelt, nach 238 in 1995. Der Jahresbericht des stationären einrichtungsbezogenen Dokumentationssystems in der Suchtkrankenhilfe (SEDOS) weist dagegen für 1996 lediglich 124 Hauptdiagnosen "Pathologisches Spielverhalten" bei den behandelten Patienten (0,9% der Beender) und 279 bzw. 130 Einzeldiagnosen "Automatenspiel" und "Glücksspiel" in 109 Einrichtungen aus. Tabelle 5: Anzahl der behandelten Glücksspieler in
Stationäre Einrichtung Die Kontakt- und Meetingübersicht der "Anonymen Spieler" (AS) weist in 1996 101 Gruppentreffen in 72 Städten auf - fünf weniger als in 1995 (Abb. 4). Darüber hinaus bestehen in zahlreichen Städten Spieler-Selbsthilfegruppen, die nicht nach dem AS-Programm vorgehen.
Vor dem Hintergrund der Therapienachfrage von Spieler/innen in ambulanten Suchtberatungsstellen und einem Vergleich mit der Therapienachfrage der geschätzten 2,5 Mio. Alkoholabhängigen ergibt sich - basierend auf den Daten für 1993 - eine Gesamtzahl von rund 100.000 beratungs- und behandlungsbedürftigen Glücksspieler/innen in Deutschland. Dies entspricht einem Anteil an der Bevölkerung von 0,12%.
Problemfelder Glücksspiele im Internet Glücksspiele werden in jüngster Zeit zunehmend auch über das Internet angeboten. In virtuellen Casinos können bundesdeutsche Spieler ihr Geld beim Roulette, Black Jack oder Poker riskieren. Aus Personalcomputern lassen sich mit Hilfe der Technik virtuelle Spielautomaten gestalten, deren Walzen sich per Maus-Klick in Bewegung setzen und im Sekundentakt über Gewinn oder Verlust entscheiden. Die Betreiber der Internet-Casinos haben ihren Geschäftssitz nicht selten in der Karibik - in Ländern, die entsprechende Möglichkeiten bieten. Aber auch europäische Anbieter von Glücksspielen nutzen inzwischen das Internet. Ein österreichisches Unternehmen (Intertops) bietet Sportwetten an - 95% der Kunden sind Bundesbürger. Eine Liechtensteiner Firma (Interlotto) verkauft Lotterietickets ("6 aus 40" sowie eine Computervariante der "Rubbellose") exklusiv über das Internet. In Finnland ist für 1997, nach bereits erfolgter Erprobungsphase, der Start virtueller Spielautomaten und Lotterien geplant, die allerdings nur für finnische Staatsbürger zugänglich sein sollen. Nach deutschem Glücksspielrecht sind derartige Angebote zur Zeit nicht genehmigungsfähig. Nichtsdestotrotz gibt es einen ersten inländischen Wettanbieter im Internet (Sportwetten GmbH Gera), der seine Lizenz in Zeiten rechtlicher Unsicherheit vor der Wiedervereinigung erworben hat. In vielen Schubladen liegen darüber hinaus Pläne, sich an dem lukrativen Geschäft zu beteiligen - bspw. bei der Stiftung Deutsche Sporthilfe (Wirtschafts-woche, Nr. 27, 26.06.97). Eine Strafverfolgung ausländischer Anbieter ist aufgrund eines rechtsfreien Raumes nicht möglich. Neufassungen der § 284, 286 StGB, die eine Einbeziehung der neuen Medien vorsehen, sollen hier in Zukunft Abhilfe schaffen (Bundesrat, Drucksache 164/2/97). Damit ist das Problem unkontrollierbarer Zugänge zum Glücksspiel aber keinesfalls gelöst. Das Internet bietet Spiele ohne Grenzen. Gespielt wird zwar von Deutschland aus, in der virtuellen Realität steht das Casino aber in der Karibik. Solange das Glücksspiel auf einer exotischen Insel stattfindet beziehungsweise die Betreiber dort ihren Geschäftssitz haben, unterliegt es nicht der hiesigen Rechtsprechung. In einer amerikanischen Studie ("Internet Gambling Report") zum Konflikt zwischen Technologie, Politik und Recht benennt Cabbot (1997) sechs Zielgruppen für eine Kontrolle von Glücksspielen im Internet:
Die Analyse der praktischen Probleme bei der Kontrolle der Zielgruppen zeigt auf, daß der einzelne Staat kaum erfolgversprechende Regulationsmöglichkeiten hat. Die größten Erfolgsaussichten bestehen noch in der Einflußnahme auf Kreditkartenunternehmen oder andere Unternehmen, die Gelegenheiten zum Geldtransfer zur Verfügung stellen. Anstrebenswert wäre eine Regelung auf internationaler Ebene, beispielsweise im Rahmen der Vereinten Nationen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, daß das Glücksspiel - bei den vorhandenen Konfliktfeldern - als ein derart gravierendes Problem angesehen wird, daß dagegen etwas unternommen werden müßte. Ein internationaler Vertrag zur Nutzung des Internets mag erreichbar sein, seine Effektivität hängt aber von universeller Akzeptanz ab. Wenn nur ein einziges Land seine Zustimmung verweigert, könnte es zum Eldorado für Internet-Casinos werden oder zur Scheinadresse für Anbieter aus der ganzen Welt. Cabbot (1997) zieht aus seiner Analyse die Schlußfolgerung, daß es letztendlich völlig irrelevant ist, ob Glücksspiele im Internet legal sind, da der Staat nur wenig unternehmen kann, um sie zu unterbinden. In den USA wird sich eine auf höchster politischer Ebene eingerichtete Kommission ("National Gambling Impact Study Commission") mit dem Problemfeld der Glücksspiele im Internet befassen. Diese Kommission hat den zweijährigen Auftrag, die sozialen und ökonomischen Auswirkungen des Glücksspiels auf die Gesellschaft zu untersuchen. Neben dem Effekt des Angebotes im Internet soll sie u.a. auch den Zusammenhang zwischen Glücksspiel, Kriminalität und pathologischem Glücksspiel beurteilen. Noch stehen einer massenhaften Nutzung allerdings einige Hindernisse im Weg, die mit der neuen Technologie verbunden sind. Der Datentransfer über das Internet braucht noch zu viel Zeit. 5 Sekunden und mehr bis zur nächsten Karte beim Black Jack können auf Dauer keinen "Zocker" reizen. In Zeiten hoher Frequentierung kann es mitunter sogar zum "Geduldspiel" werden, trotz eines schnellen Modems. Spieler erwarten darüber hinaus die unmittelbare Auszahlung erzielter Gewinne, was sich über das Internet noch nicht realisieren läßt. Der Geldtransfer ist bisher ohnehin die große Schwachstelle. Die Betreiber verlangen vom Spieler persönliche Angaben, wie beispielsweise die Kreditkartennummer, verbunden mit der Gefahr des Mißbrauchs und der Aufgabe der Anonymität. Die Kreditwirtschaft und Internet-Browser arbeiten verstärkt an der Entwicklung sicherer, vertrauenserweckender Transfersysteme, da dies nicht nur das Glücksspiel sondern den gesamten Handel über das Internet betrifft. Neue Methoden der Datenverschlüsselung und virtuelle Währungen (Digital- oder Cyber-Cash) werden in Zukunft den Zugang regeln. Die Betreiber von Glücksspielen müssen außerdem das Vertrauen der Spieler in ihre Bonität sowie in einen ordnungsgemäßen und ehrlichen Spielablauf gewinnen. Ob beim virtuellen Roulette letztendlich der Zufall oder manipulierte Programme über den Ausgang des Spiels entscheiden, ist nicht nachvollziehbar. Vor einer Teilnahme an Glücksspielen im Internet ist daher nicht zuletzt aus Gründen des mangelnden Schutzes vor Betrugsdelikten und des unsicheren Geldtransfers zu warnen. Doch die Schwierigkeiten sollten nicht darüber hinwegtäuschen, daß schon in wenigen Jahren ein attraktives Angebot mit hohem Spielanreiz vorhanden sein wird. Die Aussicht auf das Milliardengeschäft wird die Kreativität der Betreiber fördern und die Lösung der internen Probleme unaufhaltsam vorantreiben. Nach Prognosen des "International Gaming and Wagering Business"-Magazins (1997, 18, 4) werden im Jahr 2000 weltweit 170 Mio. potentielle Spieler rd. 8,6 Mrd. Dollar im Internet "verzocken". Sind die anfänglichen Hürden erst überwunden, werden sich im Internet Glücksspiele präsentieren, deren Suchtpotential als außerordentlich hoch einzuschätzen ist. Sie sind praktisch uneingeschränkt verfügbar und gewährleisten eine rasche Spielabfolge und ein breites Spektrum an Einsätzen, Gewinnen und Verlusten. Der Kontrollverlust tritt schneller ein, da bargeldlos gespielt wird. Eine "soziale Kontrolle" ist nicht mehr möglich, der Internet-"Zocker" kann sich vom virtuellen Casino im Wohnzimmer aus ruinieren, ohne daß es jemand bemerkt. Die verbleibende Zeit, bis vertrauenserweckende Systeme für den Geldtransfer entwickelt und die Spieler von der Seriosität der Anbieter überzeugt werden können, sollte für eine kreative Gestaltung präventiver Maßnahmen genutzt werden. Während der Schutz von Kindern vor einer Beteiligung am virtuellen Glücksspiel noch durchsetzbar erscheint, dürfte der Schutz vor einer Ausbeutung der Spielsucht eher unrealistisch sein. Ein Staat, der das Glücksspiel als lukrative Einnahmequelle entdeckt hat, wie nicht zuletzt der Boom der Spielbanken in Deutschland zeigt, wird allenfalls darauf achten, daß ihm potentielle Gelder nicht verlorengehen. Literatur Cabot, A. (1997): The Internet Gambling Report. Las Vegas: Trace Publication.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufsätze INDEX